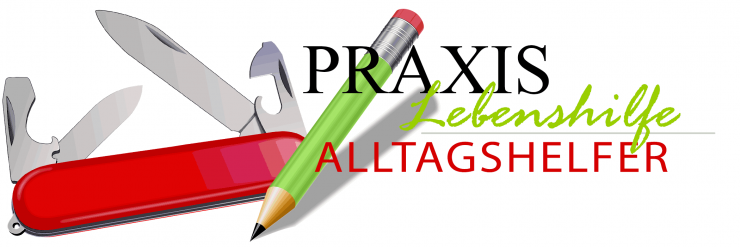Alltagshelfer und Einzelhelfer Unterschied
Alltagsbegleiter und Alltagshelfer
Was ist der Unterschied?
-
Unterschied Einzelhelfer und Alltagshelfer
-
Die genauen Unterschiede sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das liegt an den Anforderungen der zuständigen Behörde, die die Einzelhelfer mit einer jeweiligen Zulassung versehen. Als Alltagshelfer hingegen ist man weiterhin in den Tätigkeiten relativ frei und ungebunden.
-
Was machen Einzelhelfer?
-
Der Begriff Einzelhelfer wird häufig in Verbindung mit der Nachbarschaftshilfe verwendet. Jemand freiwilliges, meldet sich bei der Gemeinde als freiwilliger Nachbarschaftshelfer und bekommt dafür eine kleine Entlohnung (Aufwandsentschädigung). Um aber die Aufwandsentschädigung geltend zu machen müssen einige Anfroderungen erfüllt sein.
-
Wie viel verdient man als Einzelhelfer?
-
Zwischen Einkommen und Aufwandsentschädigung muss klar unterschieden werden. Ein Alltagshelfer hat ein Einkommen, da er Rechnungen schreibt. Ein Einzelhelfer hingegen hat eine Aufwandsentschädigung, da er die erbrachte Leistung als ehrenamtliche Tätigkeit ansieht. Die Leistungen werden dann unter bestimmten Voraussetzungen von den Pflegekassen übernommen. Die Aufwandspauschale beträgt maximal den Entlastungsbetrag in Höhe von 131,00 € im Monat. Dazu müssen die Einzelhelfer sich beim Pflegestützpunkt und / oder bei den entsprechenden Pflegekassen registrieren lassen und Anforderungen erfüllen.
-
Einzelhelfer Baden-Württemberg
-
In Baden-Württemberg musst du als Einzelhelfer:in bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um anerkannt zu werden und Leistungen über den Entlastungsbetrag abrechnen zu können:
-
Pflegekurs: Du brauchst in der Regel eine Qualifizierung im Umfang von mindestens 30 Stunden. Dieser Kurs vermittelt Grundwissen zur Pflege, Kommunikation und zum Umgang mit Demenz.
-
Erweiterte Anforderungen bei bestimmten Einsätzen: Wenn du regelmäßig hilfst oder auch bei pflegeähnlichen Tätigkeiten unterstützt, kann eine vertiefte Schulung erforderlich sein.
-
Anerkennung durch die Kommune oder einen Träger: Die Anerkennung erfolgt meist durch die Stadt oder den Landkreis. Dort bekommst du auch Informationen zu zuständigen Stellen.
-
Keine professionelle Erwerbstätigkeit: Die Unterstützung soll im nachbarschaftlichen oder ehrenamtlichen Rahmen stattfinden – nicht als regulärer Beruf.
So gehst du vor:
-
Information einholen
Wende dich an die örtliche Pflegekasse oder das Landratsamt / Stadtverwaltung. Sie nennen dir die zuständige Stelle für die Anerkennung nach § 45a SGB XI. -
Pflegekurs absolvieren
Mach einen 30-stündigen Qualifizierungskurs. Viele Träger bieten diesen kostenlos an – z. B. Wohlfahrtsverbände, Volkshochschulen oder Pflegekassen. Am Ende bekommst du eine Teilnahmebescheinigung. -
Antrag stellen
Reiche die Bescheinigung und ggf. weitere Nachweise (z. B. erweitertes Führungszeugnis) bei der zuständigen Behörde ein. Es kann sein, dass du ein Antragsformular ausfüllen musst. -
Anerkennung abwarten
Nach Prüfung erhältst du eine Bestätigung, dass du als Einzelhelfer:in anerkannt bist – und über den Entlastungsbetrag abrechnen darfst. -
Nachweise aufbewahren
Für die Abrechnung musst du Stunden dokumentieren, einfache Quittungen ausstellen oder Formulare der Pflegekasse ausfüllen. Manche Pflegekassen haben eigene Vordrucke.
-
-
Einzelhelfer Voraussetzungen in den Bundesländern
-
Es ist schade, dass es in Deutschland keine einheitliche Regelung zu den Anerkennungsmöglichkeiten für Einzelhelfer gibt. Es gibt aber auch hier wenig bis keine Informationen seitens der Bundesländer.
Dennoch einige Zusammenfassungen der einzelnen Länder:
Baden-Württemberg
Du musst volljährig sein und darfst nicht mit der betreuten Person bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sein. Innerhalb von sechs Monaten nach deinem Start musst du einen Kurs mit 20 Unterrichtseinheiten machen. Du meldest dich bei einer zuständigen Stelle vor Ort, meist ein Pflegestützpunkt oder Landratsamt.Bayern
Wenn du ehrenamtlich hilfst, kannst du anerkannt werden. Die genauen Anforderungen legt dein Landkreis oder deine Stadt fest – frag dort nach.Berlin
Früher konntest du dich dort direkt anerkennen lassen. Wie es aktuell aussieht, klärst du am besten bei der Senatsverwaltung oder Pflegekasse.Brandenburg
Auch hier brauchst du eine Anerkennung – hol dir Infos direkt bei der Kommune oder Pflegekasse. Die Regeln können von Region zu Region leicht abweichen.Bremen
In Bremen gibt’s derzeit keine landesweit einheitliche Regelung. Frag bei deiner Pflegekasse, ob du dich als Einzelhelfer:in anerkennen lassen kannst.Hamburg
Du musst volljährig sein und in Hamburg wohnen. Du bekommst max. 5 € pro Stunde, höchstens 2.400 € im Jahr – sonst gilt’s als Erwerbstätigkeit.Hessen
Auch in Hessen darfst du als Einzelperson helfen. Die Qualifikationsanforderungen hängen vom Träger oder der Pflegekasse ab – erkundige dich bei ihnen.Mecklenburg-Vorpommern
Hier gibt’s klare Regeln: Du kannst dich offiziell anerkennen lassen, z. B. mit einem Pflegekurs. Ansprechpartner ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales.Niedersachsen
Keine festen Regeln bekannt – frag bei deiner Pflegekasse oder Stadt nach, ob und wie du anerkannt werden kannst.Nordrhein-Westfalen
Du kannst ehrenamtlich oder gewerblich helfen. Die Vorgaben legt deine Stadt oder Kommune fest. Wichtig ist oft eine kurze Schulung und ein Führungszeugnis.Rheinland-Pfalz
Details bekommst du bei der Pflegekasse oder beim Landesamt. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Region.Saarland
Hier gibt es eine Landesverordnung zur Anerkennung. Melde dich bei deiner Pflegekasse – sie sagt dir, was genau gebraucht wird.Sachsen
Du kannst als Einzelperson anerkannt werden. Voraussetzung ist meist eine Grundqualifikation, etwa ein Pflegekurs. Frage bei der Landesdirektion oder Pflegekasse nach.Sachsen-Anhalt
Wie in Niedersachsen: Keine klaren Vorgaben bekannt. Am besten klärst du das direkt mit deiner Pflegekasse.Schleswig-Holstein
Auch hier ist Nachbarschaftshilfe möglich. Die Anerkennung bekommst du bei deiner Kommune oder Pflegekasse – dort erfährst du auch die Anforderungen.Thüringen
Infos bekommst du beim Landesverwaltungsamt oder der Pflegekasse. Die Anforderungen hängen von der Art deiner Tätigkeit ab.
Baden-Württemberg:
-
Qualifizierung: Mindestens 30-stündiger Pflegekurs erforderlich.
-
Anerkennung: Unbürokratisches Verfahren; Formulare online verfügbar.
Bayern:
-
Qualifizierung: Schulungen variieren; oft 40 Stunden.
-
Anerkennung: Antragstellung bei der zuständigen Behörde; Anforderungen können regional unterschiedlich sein.
Berlin:
-
Qualifizierung: Standardisierte Kurse von etwa 40 Stunden.
-
Anerkennung: Antrag bei der Senatsverwaltung für Gesundheit; regelmäßige Fortbildungen erforderlich.
Brandenburg:
-
Qualifizierung: Mindestens 30 Stunden; Inhalte wie Kommunikation und Demenz.
-
Anerkennung: Landesamt für Soziales und Versorgung zuständig; jährliche Fortbildungspflicht.
Bremen:
-
Qualifizierung: 40-stündiger Kurs mit Praxisteil.
-
Anerkennung: Sozialbehörde erteilt Anerkennung; regelmäßige Supervision empfohlen.
Hamburg:
-
Qualifizierung: Umfangreiche Schulung, oft 50 Stunden.
-
Anerkennung: Antrag bei der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz; Qualitätssicherungskonzept erforderlich.
Hessen:
-
Qualifizierung: Mindestens 30 Stunden; spezielle Module für bestimmte Krankheitsbilder.
-
Anerkennung: Regierungspräsidien zuständig; jährliche Fortbildungen nachzuweisen.
Mecklenburg-Vorpommern:
-
Qualifizierung: 40 Stunden, inklusive Erste-Hilfe-Kurs.
-
Anerkennung: Landesamt für Gesundheit und Soziales prüft Anträge; regelmäßige Berichterstattung erforderlich.
Niedersachsen:
-
Qualifizierung: 30 bis 40 Stunden; Inhalte variieren je nach Anbieter.
-
Anerkennung: Landesbehörde für Soziales zuständig; Qualitätssicherungsmaßnahmen notwendig.
Nordrhein-Westfalen:
-
Qualifizierung: Mindestens 40 Stunden; zusätzliche Praktika empfohlen.
-
Anerkennung: Landschaftsverbände erteilen Anerkennung; regelmäßige Evaluationen vorgesehen.Bundesportal
Rheinland-Pfalz:
-
Qualifizierung: 30 Stunden; Fokus auf Alltagsbegleitung und Aktivierung.Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
-
Anerkennung: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zuständig; Fortbildungspflicht alle zwei Jahre.
Saarland:
-
Qualifizierung: Umfang variiert; oft um die 40 Stunden.
-
Anerkennung: Ministerium für Soziales prüft Anträge; Qualitätssicherungsnachweise erforderlich.
Sachsen:
-
Qualifizierung: Mindestens 32 Stunden; spezielle Module für Demenzbetreuung.
-
Anerkennung: Landesdirektion Sachsen zuständig; jährliche Fortbildungen verpflichtend.
Sachsen-Anhalt:
-
Qualifizierung: 40 Stunden; Kombination aus Theorie und Praxis.
-
Anerkennung: Landesverwaltungsamt erteilt Anerkennung; regelmäßige Berichterstattung notwendig.
Schleswig-Holstein:
-
Qualifizierung: 30 bis 40 Stunden; Inhalte wie Kommunikation, Pflegegrundlagen.
-
Anerkennung: Landesamt für soziale Dienste prüft Anträge; Fortbildungen alle zwei Jahre erforderlich.
Thüringen:
-
Qualifizierung: Mindestens 35 Stunden; Fokus auf praktische Fähigkeiten.
-
Anerkennung: Thüringer Landesverwaltungsamt zuständig; Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgeschrieben.
Hilfreiche Informationen für Alltagshelfer und Suchende
Abtretungserklärung
In bestimmten Situationen kannst du als Leistungsanbieter direkt mit der Pflegekasse abrechnen. Dafür benötigt der Pflegebedürftige eine Abtretungserklärung. Diese Anfrage kann zusammen mit der Rechnung direkt an die zuständige Pflegekasse gesendet werden.
Angebote zur Unterstützung im Alltag
Gemäß § 45a SGB XI gibt es spezielle Angebote, die darauf abzielen, Pflegepersonen zu entlasten und Pflegebedürftigen zu helfen, möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. Diese Angebote unterstützen dich dabei, deinen Alltag selbstständig zu meistern und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Hierzu zählen nicht nur Betreuungsangebote, sondern auch verschiedene Entlastungsleistungen. Wichtig ist, dass diese Angebote von der zuständigen Landesbehörde anerkannt werden müssen, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
Aufwandsentschädigung
Die Aufwandsentschädigung ist eine Form der Anerkennung für dein bürgerschaftliches Engagement. Obwohl das Ehrenamt normalerweise freiwillig und unentgeltlich ist, wird diese Entschädigung als finanzielle Wertschätzung betrachtet.
Auslagenersatz
Auslagen sind Kosten, die im Rahmen deiner Aufgaben entstehen. Der Auslagenersatz bezieht sich auf den steuerfreien Ersatz dieser Auslagen durch deinen Arbeitgeber, wenn du entsprechende Nachweise vorlegst.
Arbeitslosengeld I (ALG I)
ALG I bietet dir eine soziale Absicherung, falls du deine Beschäftigung verloren hast und vorübergehend kein Einkommen erhältst. Die Regelungen dafür findest du im dritten Sozialgesetzbuch (SGB III). Dein Anspruch hängt davon ab, ob und wie lange du in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast.
Arbeitslosengeld II (ALG II)
Umgangssprachlich auch als Hartz IV bekannt, ist ALG II eine Unterstützung für hilfebedürftige Personen oder Bedarfsgemeinschaften, die erwerbsfähig sind. Wenn du nicht erwerbsfähig bist, kannst du Sozialgeld erhalten, allerdings nur in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen Person. Die Rechtsgrundlage hierfür ist das zweite Sozialgesetzbuch (SGB II).
Ehrenamtspauschale
Die Ehrenamtspauschale bietet dir einen steuer- und sozialversicherungsfreien Freibetrag von 720 Euro pro Jahr. Dies gilt für ehrenamtlich Tätige in gemeinnützigen Organisationen. Beträge über diesem Freibetrag sind jedoch steuerpflichtig. UPDATE: Ab 2021 wird dieser Betrag auf 840 Euro angehoben.
Entlastungsbetrag
Pflegebedürftige aller Pflegegrade haben Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro, wenn sie ambulant versorgt werden. Dieser Betrag kann ohne Antragstellung genutzt werden und dient zur Erstattung von Aufwendungen für qualitätsgesicherte Angebote zur Stärkung der Selbstständigkeit. Unverbrauchte Beträge können in den folgenden Monaten übertragen werden, und nicht genutzte Beträge am Jahresende können bis zum Ende des darauffolgenden Kalenderhalbjahres abgerufen werden.
Haftpflichtversicherung
Eine private Haftpflichtversicherung schützt dich vor unberechtigten Schadensersatzansprüchen im privaten Bereich. Sie deckt verschiedene Schadensarten ab, wobei es spezifische Regelungen gibt.
Häuslichkeit bzw. häusliche Umgebung
Der Begriff „häusliche Umgebung“ ist eng mit der „häuslichen Pflege“ verbunden und umfasst den eigenen Haushalt sowie Haushalte von Pflegepersonen oder Altenheimen. Diese Definition ist entscheidend für den Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Institutionskennzeichen
Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein wichtiges Merkmal für die Abrechnung medizinischer und rehabilitativer Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern. Es wird benötigt, um die Abrechnungen effizient zu gestalten.
Leistungen der Pflegeversicherung
Hier eine kurze Übersicht über die Leistungen bei häuslicher Pflege:
- Finanzielle Unterstützung (Pflegegeld)
- Pflegedienste und Pflegesachleistungen
- Kombinationsleistung
- Einzelpflegekräfte
- Verhinderungspflege
- Tagespflege und Nachtpflege
- Angebote zur Unterstützung im Alltag und Entlastungsbetrag
- Soziale Absicherung der Pflegeperson
- Pflegekurse für Angehörige
- Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
- Pflegehilfsmittel
- Zuschüsse zur Wohnungsanpassung
Zu den Leistungen der teil- und vollstationären Pflege gehören:
- Vollstationäre Versorgung
- Teilstationäre Versorgung (Tages- oder Nachtpflege)
- Kurzzeitpflege
- Medizinische Versorgung von Heimbewohnern
- Zusätzliche Betreuung in stationären Einrichtungen
Nachbarschaftshilfe
Nachbarschaftshilfe ist eine freiwillige Unterstützung von Personen aus deinem sozialen Umfeld, die nicht gegen Bezahlung erfolgt und nicht im eigenen Haushalt stattfindet.
Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftigkeit kann schleichend oder plötzlich eintreten, etwa nach einem Schlaganfall. Ein regelmäßiger Unterstützungsbedarf im Alltag kann ein Hinweis darauf sein. Nach § 14 SGB XI sind Personen pflegebedürftig, wenn sie aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen auf Hilfe angewiesen sind. Die Pflegebedürftigkeit muss dauerhaft bestehen und eine gewisse Schwere aufweisen.
Pflegegeld
Ab Pflegegrad 2 kannst du anstelle von häuslicher Pflegehilfe monatliches Pflegegeld beantragen. Die Höhe des Pflegegeldes variiert je nach Pflegegrad:
- Pflegegrad 2: 316 Euro
- Pflegegrad 3: 545 Euro
- Pflegegrad 4: 728 Euro
- Pflegegrad 5: 901 Euro
Das Geld wird direkt an dich ausgezahlt und kann flexibel verwendet werden.
Pflegegrad
Seit dem 1. Januar 2017 gibt es fünf Pflegegrade, die sich nach den Einschränkungen deiner Selbstständigkeit richten. Die Feststellung erfolgt durch qualifizierte Gutachter anhand wichtiger Lebensbereiche wie Mobilität und soziale Kontakte.
Die Beantragung von Pflegeleistungen erfolgt bei der zuständigen Pflegekasse. Du kannst den Antrag auch mündlich stellen. Voraussetzung ist, dass du innerhalb der letzten zehn Jahre zwei Jahre lang Beiträge zur Pflegeversicherung gezahlt hast.
Pflegekasse
Die Pflegekasse ist Teil der sozialen Pflegeversicherung und bei den Krankenkassen angesiedelt. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Sicherstellung deiner Ansprüche.
Pflegekurs
Die Pflegekassen bieten kostenlose Schulungskurse für Angehörige oder Interessierte an, um das Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und notwendige Kenntnisse zu vermitteln. Diese Kurse können in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungseinrichtungen durchgeführt werden.

Du suchst einen Alltagsbegleiter, der mit der Krankenkasse / Pflegekasse abrechnen kann? Das solltest du berücksichtigen!
Was macht ein Einzelhelfer?
Die Aufgaben als Einzelhelfer:in hängen nicht von einem festen Plan ab – sie richten sich nach dem, was die betreute Person wirklich braucht. Du bist nicht nur Unterstützung, sondern Begleitung. Was ihr gemeinsam macht, soll im Einklang mit dem stehen, was dem Menschen gegenüber wichtig ist. Besonders bei Aktivitäten, die Beteiligung und Nähe erfordern, zählt eure gegenseitige Absprache.
Hier zehn typische Aufgaben, die du im Alltag übernehmen kannst – immer angepasst an die Situation vor Ort:
-
Du begleitest zu Arztterminen, Behörden oder beim Einkaufen.
-
Ihr geht gemeinsam spazieren oder verbringt Zeit draußen.
-
Ihr kocht, bastelt, spielt oder singt zusammen – was Freude bringt.
-
Du hörst zu, sprichst mit der Person über Dinge, die ihr wichtig sind – Sorgen, Erinnerungen, Wünsche.
-
Ihr macht gemeinsam leichte Haushaltsarbeiten, wie Wäsche aufhängen oder den Geschirrspüler ausräumen.
-
Auch kleine handwerkliche oder gärtnerische Tätigkeiten könnt ihr gemeinsam angehen.
-
Du hilfst bei der Suche nach weiteren Unterstützungsangeboten – z. B. einem Essen-auf-Rädern-Dienst oder therapeutischen Angeboten.
-
Ihr besucht zusammen Sport- oder Kulturveranstaltungen, wenn Interesse besteht.
-
Du unterstützt bei der Versorgung von Haustieren – zum Beispiel beim Gassi gehen.
Es geht nicht nur um Hilfe – es geht um Miteinander.